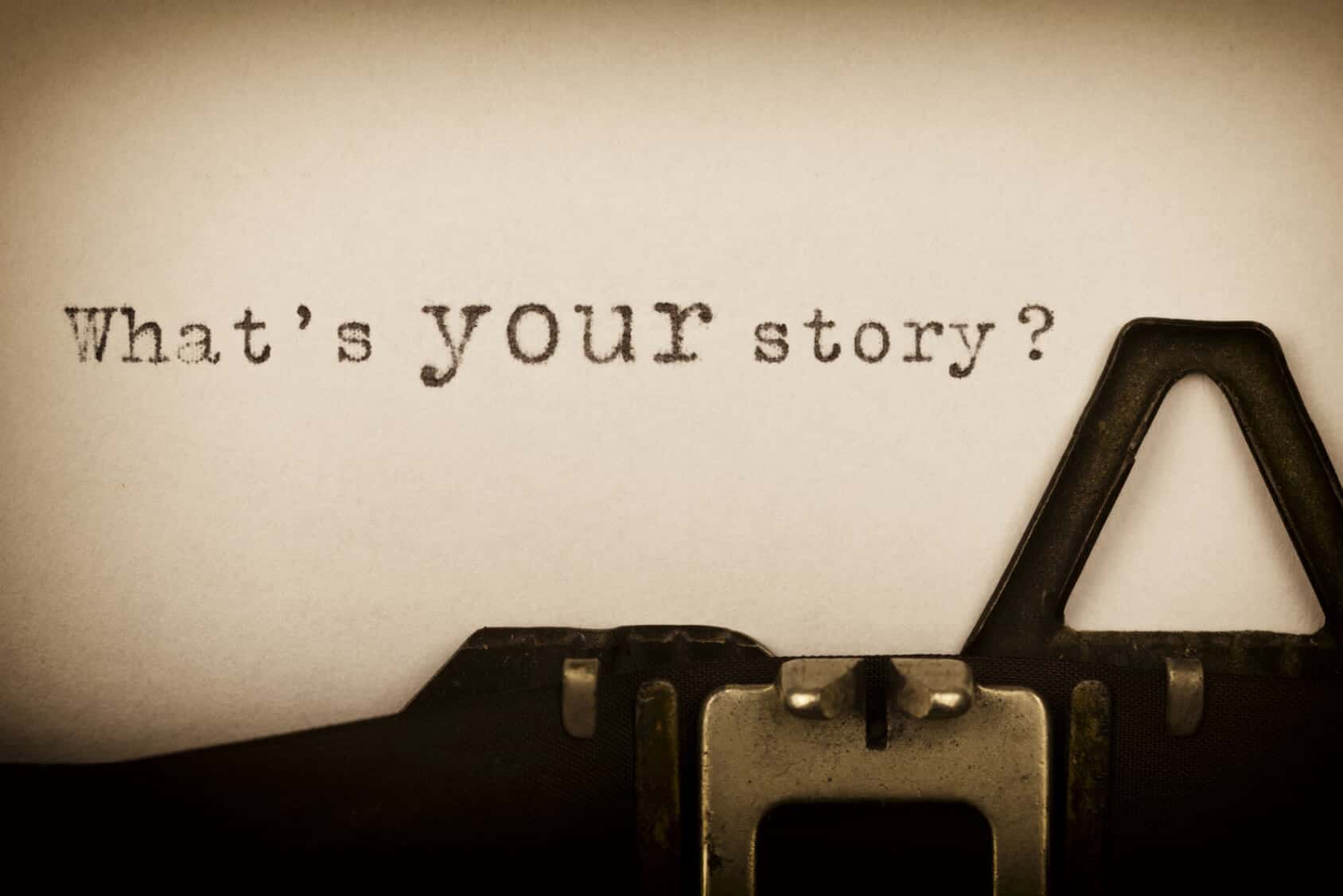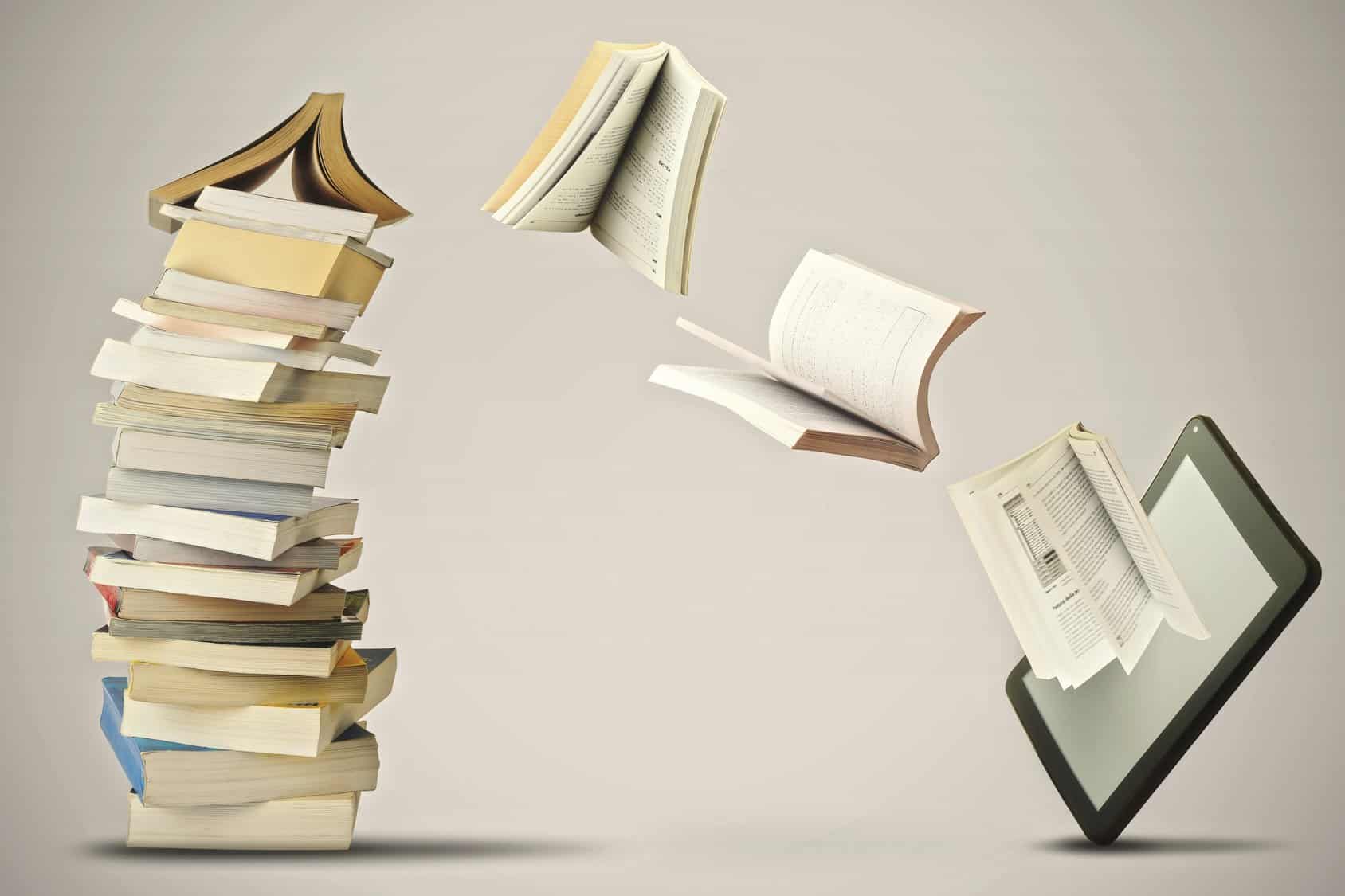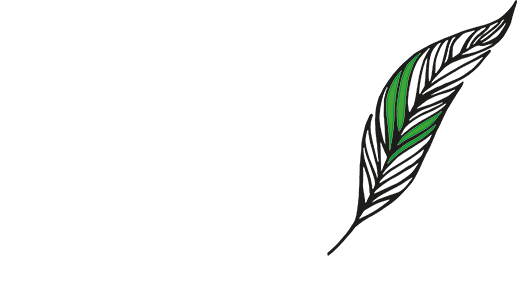Wolle färben mit Pflanzenfarben
Schlüsselblumengelb, Krappwurzelrot und Indigoblau

Sarah hat zu diesem Anlass für Barbaras Portal „Schreiben als Beruf“ einen Artikel mit Tipps für die (gesündere) Schreibtischarbeit geliefert. Wir haben dafür einen Beitrag von der lieben Textine Birte – über die ihr am Ende des Artikels noch etwas mehr erfahrt – als kleines Osterei bekommen. Von ihr stammt hier im Blog auch schon der sehr unterhaltsame Text über Wörter mit Migrationshintergrund. Diesmal hat sie unsere gemeinsame Leidenschaft für Pflanzen, Wolle und Selbstgemachtes als Inspiration genutzt: Ihr Artikel dreht sich um das Färben von Wolle mithilfe von Pflanzen.
Hier kommt Birtes Bloghoppel-Text:
Pflanzen für alle Farben
Schon vor Erfindung der künstlichen Farbstoffe haben die Menschen gerne bunte Kleidung getragen, doch statt wie heute mit chemischen Farben wurden sie eben mit Pflanzen gefärbt. Wenn man sich in der Natur umschaut, finden sich diverse geeignete Gewächse. Am häufigsten sind vermutlich Pflanzen, mit denen man gelb färben kann. Mit Schafgarbe, Frauenmantel, Milchlattich, Birkenblättern, Bärenklau, Apfelbaumrinde, Zwiebelschalen und Schlüsselblumen lassen sich diverse Gelbtöne erzielen, um nur ein paar zu nennen. Auch Spinat kann zum Färben verwendet werden, er ergibt ein leuchtendes Messinggelb, allerdings landet er bei mir normalerweise auf dem Teller statt im Färbebad. Es gibt ja genug Alternativen.

Auch für Brauntöne gibt es einige Pflanzen zur Auswahl, wie zum Beispiel die Rinde von Apfel- und Kirschbaum, Akazie und Erle, aber auch Rosskastanienblätter und grüne Walnussschalen. Wobei die Walnussschalen ein Sonderfall sind: Mit ihnen kann man auch kalt färben, was mit den meisten anderen Pflanzen nicht funktioniert. Dazu schichtet man Wolle und Schalen in einen Steinguttopf, bedeckt das Ganze mit Wasser und lässt es zwei Tage lang ziehen. Das Färbebad kann man anschließend noch für eine kochende Färbung verwenden.
Für Rottöne wird die Auswahl schon kleiner, das geht zum Beispiel mit Krappwurzel, Kokosfasern oder Rotholz. Wenn man ein richtig leuchtendes Rot haben möchte, muss man allerdings zur Cochenille greifen, das zwar eine Naturfarbe ist, aber eben nicht pflanzlich: Es handelt sich um Schildläuse. Die Wolle auf dem Bild habe ich mit Krapp gefärbt:

Für Grünfärbungen empfiehlt es sich, als Grundlage direkt eine Pflanze zu wählen, die ein grünstichiges Gelb ergibt wie zum Beispiel Johanniskraut oder Rainfarn. Um richtig grüne Wolle zu bekommen, muss die Farbe dann noch mithilfe eines Metallsalzes wie Eisensulfat oder Zinnchlorid weiterentwickelt werden. Erfahrene Färberinnen und Färber packen auch gerne rostige Eisennägel mit ins Färbebad oder benutzen einen Kupfertopf dafür.
Die richtig hohe Kunst ist allerdings die Blaufärbung mit Indigo oder Wau. Nicht umsonst war Blaufärber im Mittelalter ein eigener Beruf. Der blaue Farbstoff ist nicht wasserlöslich und muss durch eine Art Reduktionsprozess in eine gelbe Lösung überführt werden, in der die Wolle gelb gefärbt wird. Erst an der Luft verblaut sie dann durch den Kontakt mit dem Sauerstoff. Der große Haken an Blaufärbungen ist allerdings der Geruch: Um den blauen Farbstoff aus dem Waid oder Indigo herauszulösen, braucht es entweder eine Menge Chemie – oder literweise geklärten Urin. Der Urin muss dafür zwei Wochen an einem warmen Ort fermentieren. Dann wird er gefiltert, das Indigopulver zugesetzt, und dann muss er weitere zwei bis vier Wochen fermentieren. Wer in der Stadt wohnt, sollte das vielleicht lieber nicht ausprobieren, wenn man es sich nicht mit den Nachbarn verscherzen will …

Und wie geht das jetzt?
Man braucht zunächst einmal einen großen Topf. Ich meine richtig groß. Bei den meisten Färbepflanzen muss man 100 % des Wollgewichts in Pflanzen dazugeben. Wenn ich also ein Kilo Wolle färben will, benötige ich zum Beispiel ein Kilo Birkenblätter oder ein Kilo Brennnesseln. Und die haben ein entsprechendes Volumen. Es bietet sich an, dafür einen Einkochautomaten zu verwenden. Dazu kommt ein großer Holzlöffel. Manche Farben reagieren mit Metallen, deshalb sollte man grundsätzlich einen Holzlöffel nehmen.
Vor dem Färben muss die saubere Wolle noch gebeizt werden, damit sie die Farbe gut aufnimmt. Sonst kann es passieren, dass die Farbe nicht wasch- und lichtecht wird, und das wäre schade nach der ganzen Mühe. Es gibt ein paar Pflanzen, die so viel Gerbstoff enthalten, dass eine Vorbeize nicht nötig ist, wie zum Beispiel die Amerikanische Schwarznuss oder Kirschbaumrinde. Meistens kommt man aber um eine Vorbeize nicht herum. Das gebräuchlichste Beizmittel ist der Alaun. Manche Menschen verwenden auch Kaliumbichromat, was allerdings giftig ist. Wer nicht weiß, wie man damit umgeht und das Färbebad anschließend richtig entsorgt (!), sollte davon lieber die Finger lassen. Ich habe mich auf Alaun beschränkt und die anderen Beizmittel kein bisschen vermisst.
Die gebeizte Wolle wird dann ins Färbebad gegeben und muss bei gelegentlichem vorsichtigen Umrühren mindestens eine Stunde vor sich hin köcheln. Nicht zu stark rühren, sonst verfilzt sie. Anschließend gut ausspülen und trocknen lassen. Das Färbebad aber bitte nicht gleich entsorgen, man kann dieselbe Farbflotte ohne weiteres dreimal verwenden. Die zweite und dritte Färbung ist dann natürlich nicht mehr ganz so farbintensiv, kann aber auch sehr schön aussehen. Die dritte Färbung mit Krapp ergab bei mir lachsfarbene Wolle:

Eine weitere Möglichkeiten ist, mit der gebrauchten Flotte bereits gefärbte Wolle noch einmal überzufärben. Gelbe Wolle, die noch einmal mit Krapp überfärbt wird, wird beispielsweise orange. Gibt man sie hingegen in die blaue Farbküpe, bekommt man grüne Wolle. Interessant wird es auch, wenn man als Grundlage keine reinweiße Wolle verwendet. Oder ungesponnene Rohwolle und dann verschiedene Farben zusammenkardiert, bevor man sie verspinnt. Der Experimentierfreude sind da keine Grenzen gesetzt.

Wer es direkt einmal ausprobieren will, bitte sehr:
Vorbeize mit 15 % Alaun
100 % Frauenmantel, getrocknet
Ergibt ein kräftiges Gelb
Den Topf mit lauwarmen Wasser füllen. Den Alaun in etwas heißem Wasser auflösen, zum lauwarmen Wasser hinzugeben, gut umrühren und die gewaschene Wolle hineinlegen. Eine Stunde leicht kochen lassen, dabei gelegentlich vorsichtig wenden. Anschließend in der Beizbrühe auskühlen lassen. Herausnehmen, auspressen und trocknen lassen, wenn man sie nicht direkt färben will. Die getrockneten Frauenmantelblätter in ausreichend Wasser eine Stunde auskochen. Die Wolle einlegen und so viel Wasser hinzufügen, dass die Wolle sich im Wasser bewegen kann. Dann eine Stunde lang köcheln lassen. Die Wolle im Farbbad abkühlen lassen, herausnehmen, gründlich spülen und trocknen lassen.
Und? weißt du schon, was du mit der Wolle anfertigen willst?


Birte Mirbach
Diplomübersetzerin
Birte Mirbach ist Diplomübersetzerin (FH) und übersetzt aus dem Englischen, Niederländischen, Flämischen und Spanischen. Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung als freiberufliche Übersetzerin.
Sie liebt kreative Übersetzungen sowie Landwirtschafts- und Gartenbauthemen, aber auch Romane und Handarbeitsbücher gehören zu ihrem Portfolio.
Aktuell sind u. a. zwei von ihr übersetzte Handarbeitsbücher erhältlich: „Socken häkeln für die ganze Familie“ und „Onesiegurumi – noch mehr Häkelspaß“ von Sascha Blase-van Wagtendonk, außerdem erschienen 2022 „Texturen stricken“ von Erika Knight und der Roman „Die Hennakünstlerin“ von Alka Joshi – als Auftakt der erfolgreichen Jaipur-Trilogie – in ihrer Übersetzung. Der Abschluss der Reihe „Die Parfümeurin von Paris“ wurde 2024 veröffentlicht. Frisch erschienen sind außerdem die Dark-Romance-Romane „Twisted“ und „Crossed“ von Emily McIntire; der letzte Band dieser Serie „Hexed“ erscheint Ende Mai 2025.
© Foto: Ringfoto Stadthagen
Das könnte Sie auch interessieren:
Selbstgemischter Kräutertee
Gartenfieber
Die sogenannte Vegetarierwolle
* „Der Unterschied zwischen dem beinahe richtigen Wort und dem richtigen ist derselbe wie zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitz“ – Mark Twain